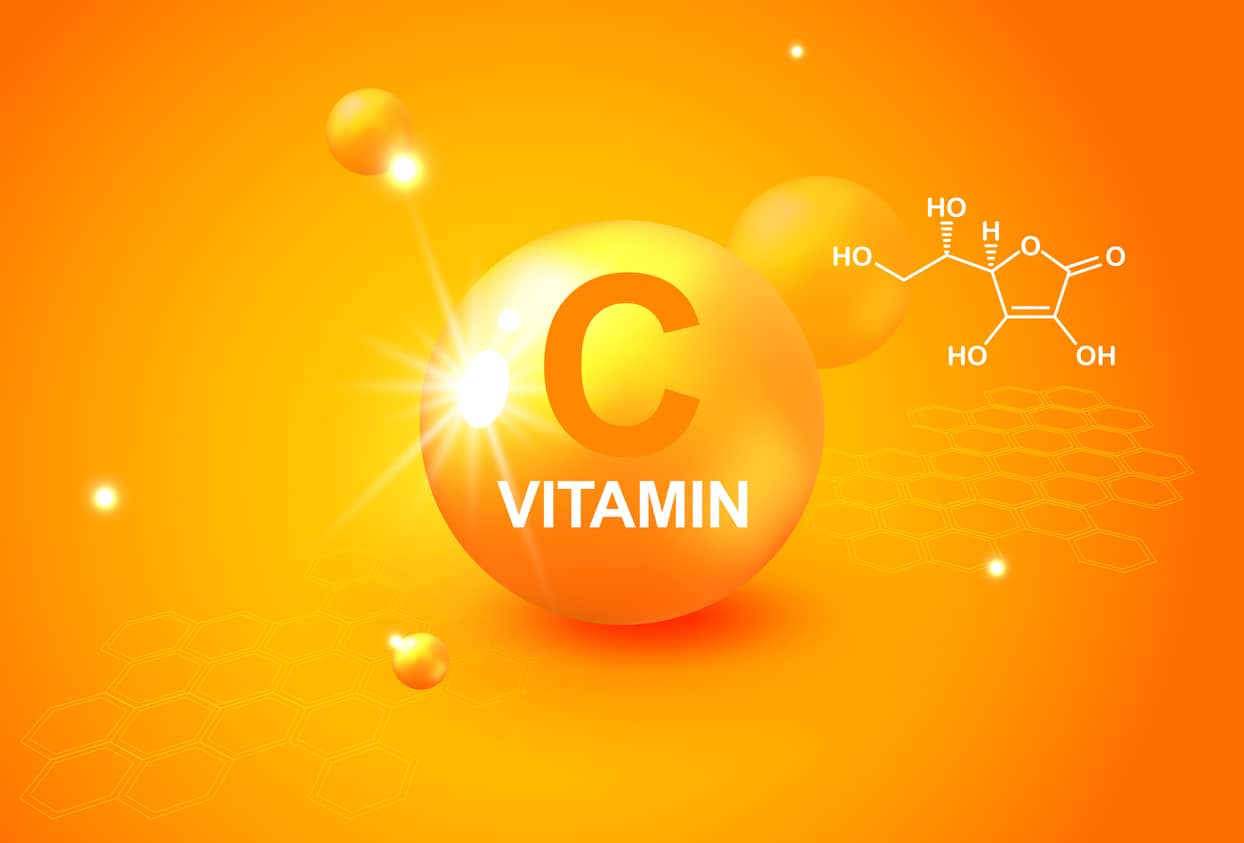Wie der Mensch seine Fähigkeit verlor, Vitamin C selbst zu bilden – und warum das bis heute seine Gesundheit prägt
Die Entdeckung eines unsichtbaren Helden
Die Geschichte von Vitamin C beginnt auf hoher See. Über Jahrhunderte hinweg war Skorbut die Geißel der Seefahrer – eine Krankheit, die mit Zahnfleischbluten, Muskelschwäche und inneren Blutungen einherging. Ganze Expeditionen scheiterten daran, weil den Seeleuten auf langen Reisen frisches Obst und Gemüse fehlte.
1747 führte der schottische Schiffsarzt James Lind eines der ersten kontrollierten medizinischen Experimente der Geschichte durch. Er teilte Skorbut-kranke Matrosen in Gruppen und testete verschiedene Diäten. Nur jene, die Zitronen und Orangen erhielten, erholten sich vollständig. Damit war der Grundstein zur Entdeckung des „Anti-Skorbut-Vitamins“ gelegt.
Fast 200 Jahre später gelang es, den geheimnisvollen Stoff chemisch zu identifizieren. Der ungarische Biochemiker Albert Szent-Györgyi isolierte 1928 eine kristalline Substanz aus Nebennieren und Paprika, die er „Hexuronsäure“ nannte. 1932 wurde klar: Diese Substanz war identisch mit dem Wirkstoff, der Skorbut verhinderte. Szent-Györgyi erhielt 1937 den Nobelpreis für Medizin – und die Welt hatte ein neues Vitamin: Ascorbinsäure, das heutige Vitamin C.
Die industrielle Revolution des Vitamins
In den 1930er-Jahren gelang erstmals die synthetische Herstellung von Vitamin C. Schon bald wurden Tabletten, Pulver und Brausepräparate populär – und Vitamin C wurde zum Symbol moderner Gesundheitsvorsorge.
- Unentbehrlich für die Kollagenbildung
- Beteiligt an der Hormonproduktion
- Schützt Zellen vor oxidativem Stress
- Stärkt das Immunsystem
In den 1970er-Jahren rückte der zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling Vitamin C ins Rampenlicht. Er vermutete, dass hohe Dosen nicht nur Erkältungen, sondern auch Krebs vorbeugen könnten. Auch wenn diese Hypothesen bis heute umstritten sind, machten sie deutlich: Vitamin C ist weit mehr als ein Nahrungsergänzungsmittel – es ist ein zentraler Faktor für Gesundheit und Widerstandskraft.
Der verlorene Stoffwechselweg: Warum der Mensch kein Vitamin C mehr bildet
Fast alle Tiere auf der Erde können Vitamin C selbst herstellen – Hunde, Katzen, Ziegen, Ratten oder Pferde produzieren es in der Leber (bei Vögeln in der Niere) aus Glukose. Beim Menschen jedoch – ebenso wie bei seinen nächsten Verwandten, den Affen, sowie bei Meerschweinchen – ist dieser Prozess blockiert. Der Grund: Das Enzym L-Gulonolacton-Oxidase (GULO) wird aufgrund eines defekten Gens nicht mehr gebildet.
Dieser Gendefekt entstand vermutlich vor etwa 40 Millionen Jahren, als die Vorfahren des Menschen in tropischen Regionen lebten, in denen Früchte im Überfluss vorhanden waren. Unter diesen Bedingungen war der Verlust der Synthesefähigkeit kein Nachteil – Vitamin C war täglich in ausreichender Menge über die Nahrung verfügbar. Erst viel später, mit Klimawandel und Ernährungsumstellungen, wurde dieser Verlust zum Problem: Der Mensch wurde abhängig von der Zufuhr eines Vitamins, das er einst selbst produzierte.
Tiere im Vorteil: Wenn der Körper selbst zur Apotheke wird
Dass Tiere Vitamin C selbst bilden können, ist kein nebensächlicher Luxus – es ist ein massiver evolutionärer Vorteil. Bei Stress, Infektionen oder Verletzungen steigern viele Tierarten ihre körpereigene Vitamin-C-Produktion um das 10- bis 20-Fache. So neutralisieren sie freie Radikale, stabilisieren ihre Nebennieren und regulieren Entzündungen.
Eine Ziege kann unter Stress mehrere Gramm Vitamin C pro Tag synthetisieren – umgerechnet auf den Menschen wären das 10–15 Gramm täglich. Menschen hingegen besitzen diesen Regulationsmechanismus nicht. In Stressphasen, bei Infekten oder intensiver körperlicher Belastung sinken die Vitamin-C-Spiegel, gerade dann, wenn der Körper den Stoff am dringendsten benötigt.
Moderne Zeiten, alter Mangel
Heute ist klassischer Skorbut selten, doch suboptimale Vitamin-C-Spiegel sind weit verbreitet. Chronischer Stress, Medikamente, Rauchen, Umweltgifte und unausgewogene Ernährung erhöhen den Bedarf erheblich.
Studien zeigen, dass Entzündungen, Infekte und Operationen den Vitamin-C-Verbrauch vervielfachen können. Viele Menschen erreichen in solchen Phasen trotz ausgewogener Ernährung keine ausreichenden Blutspiegel – der Körper verbraucht das Vitamin schlicht zu schnell.
Eine Übersicht hochwertiger Vitamin-C-Präparate findest du hier bei Supplementa.
Infusionstherapie: Zurück zu physiologischen Spiegeln
Während der Darm bei oraler Aufnahme nur begrenzte Mengen Vitamin C aufnehmen kann umgeht eine Vitamin-C-Infusion diesen Engpass vollständig. Mit intravenösen Infusionen lassen sich Blutkonzentrationen erreichen, die jenen ähneln, die Tiere in Stresssituationen selbst produzieren.
Diese hohen Spiegel ermöglichen Vitamin C, im gesamten Körper als Antioxidans, Entzündungsregulator und Zellschutzfaktor zu wirken. Besonders hilfreich ist die Infusionstherapie:
- bei akuten oder chronischen Infekten
- nach Operationen oder Verletzungen
- bei starker körperlicher oder psychischer Belastung
- zur Regeneration bei oxidativem Stress (z. B. durch Rauchen, Umweltgifte oder intensiven Sport)
Vitamin C – Das Relikt einer vergessenen Superkraft
Vitamin C ist mehr als ein Mikronährstoff – es ist ein evolutionäres Erbe, das uns an unsere biologische Vergangenheit erinnert. Während Tiere es noch immer selbst herstellen, müssen wir es täglich zuführen – und das Versäumnis, diese Versorgung sicherzustellen, hat weitreichende Folgen für Immunsystem, Energiehaushalt und Zellgesundheit.
Vitamin C ist damit Symbol für beides: Verwundbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Menschen – ein Molekül, das einst selbstverständlich war und das wir heute bewusst nutzen müssen, um gesund zu bleiben.
Ein besonders gut verträgliches Präparat ist das Ester-C Plus von i like it clean – ein säurefreies Vitamin-C-Produkt mit hervorragender Bioverfügbarkeit.
Fazit
Die Geschichte von Vitamin C ist die Geschichte einer verlorenen Superkraft – und zugleich die eines medizinischen Fortschritts. Vom Zitronensaft der Seefahrer über den Nobelpreis für seine Entdeckung bis hin zur modernen Infusionstherapie spannt sich der Bogen eines Vitamins, das weit mehr ist als nur ein Nährstoff: Es ist ein biochemischer Schutzschild, der einst in uns selbst aktiv war – und den wir heute wiederentdecken.
📚 Quellen & weiterführende Literatur
- Szent-Györgyi A. Observations on the function of peroxidase systems and the chemistry of the adrenal cortex. Biochemical Journal. 1928.
- Lind J. A Treatise of the Scurvy. Edinburgh: Sands, Murray and Cochran, 1753.
- Pauling L. Vitamin C and the Common Cold. W.H. Freeman, 1970.
- Levine M et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers. Proc Natl Acad Sci USA. 1996;93(8):3704–3709.
- Padayatty SJ et al. Vitamin C as an antioxidant: evaluation of its role in disease prevention. J Am Coll Nutr. 2003;22(1):18–35.
- Frei B, Traber MG. The new US dietary reference intakes for vitamins C and E. Am J Clin Nutr. 2001;75(3):491–499.